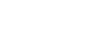Mehrere Minuten in einer engen Röhre liegen, die an einen Sarg erinnert. Den Blick an die wenige Zentimeter entfernte Decke gerichtet. Und dabei ohrenbetäubendes Geratter ertragen, ohne zu wissen, wann genau die Tortur vorbei ist: Für Menschen mit Platzangst kann eine Magnetresonanztomografie (MRT) eine Qual sein. Nach Aussagen von radiologischen Praxen bekommen ungefähr 15 Prozent der Patienten dabei Probleme. Darüber hinaus gibt es Menschen, die sich erst gar nicht überwinden können, zu einer MRT-Untersuchung zu gehen. Schließt man diese ein, leiden Schätzungen zufolge sogar 30 Prozent der Patienten unter Platzangst in der Röhre. Hersteller von Kernspintomografen bemühen sich deshalb, weniger furchteinflößende Geräte zu bauen.
Denn die MRT ist ein sehr wichtiges Diagnoseverfahren. Durchschnittlich werden in Deutschland pro tausend Einwohner jedes Jahr in etwa hundert Kernspinuntersuchungen durchgeführt. Radiologische Praxen machen damit über die Hälfte ihrer Einnahmen. Gerade in der Orthopädie und der Neurologie erleichtern MRT-Bilder die Suche nach den Ursachen von Beschwerden: Die Aufnahmen bilden sowohl gerissene Bänder, Knorpelschäden und Bandscheibenvorfälle als auch Tumoren und Entzündungen im Gehirn detailliert ab. Anders als bei CT und Röntgen fällt dabei keine Strahlenbelastung für den Patienten an. Mittels mehrerer MRT-Untersuchungen kann auch der Verlauf von Erkrankungen dokumentiert werden.
Dass herkömmliche Kernspintomografen als Röhren konstruiert sind, hat physikalische Gründe: Für gute Aufnahmen ist ein starkes homogenes Magnetfeld nötig. Das lässt sich am einfachsten durch eine lange elektrische Spule erzeugen, die in der Wand der Röhre verborgen ist.
Gute Betreuung wichtig
Wie können Menschen mit Platzangst trotzdem im MRT untersucht werden? Der Radiologe Dr. Hinrich Wieder aus Dornhagen hält es für essenziell, gut zu beraten und aufzuklären: "Vorher besprechen wir mit dem Patienten genau, was bei der Kernspintomografie geschieht." Manchen hilft auch, wenn Musik über Kopfhörer eingespielt wird. Über den Kopfhörer kann das Personal während der Aufnahme außerdem jederzeit Informationen weitergeben. Treten dennoch Probleme auf und der Patient bricht die Untersuchung ab, erhält er einen weiteren Termin für einen zweiten Anlauf.
"Dazu sollte er dann möglichst eine Begleitung mitbringen", sagt Wieder. Die Vertrauensperson kann im Raum bleiben, mit dem Patienten reden und beruhigend auf ihn einwirken. "Außerdem können wir dem Patienten ein Beruhigungsmittel verabreichen, und der Angehörige fährt ihn anschließend nach Hause."
Rundum-Ausblick statt Röhre
Auch die Hersteller von Kernspintomografen haben das Problem mit der Platzangst erkannt. Deshalb haben Firmen wie Philips und Hitachi sogenannte offene MRTs konstruiert. Die Spule zum Erzeugen des Magnetfelds ist dabei zweigeteilt: Ein Teil steckt in einer Bodenplatte unter dem Patienten, der andere Teil in der Deckplatte über dem Patienten. So liegt der Patient wie in einem Sandwich auf einer Liege und kann zur Seite hin nach draußen sehen.
Das mindert die Platzangst und bringt weitere Vorteile: Begleitpersonen haben Sichtkontakt. Gerade bei Kindern kann das wichtig sein. Stark übergewichtige Personen passen besser in ein solches Gerät als in eine enge Röhre. Und wenn Bereiche an der Seite des Körpers dargestellt werden sollen, wie zum Beispiel Schulter oder Ellenbogen, lassen sie sich optimal in der Mitte platzieren. Professor Frank Fischbach von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg benutzt offene MRTs, um gezielt Gewebsproben zu entnehmen, zum Beispiel bei Lebertumoren. Auch Mittel für die lokale Therapie platziert er mit der Technik im entsprechenden Körperbereich.
Herausforderungen offener Kernspintomografen
Trotz dieser Vorteile haben sich offene MRTs bisher noch nicht flächendeckend durchgesetzt – in Deutschland gibt es sie an etwa achtzig Standorten (einige finden Sie hier). Ein Grund dürfte der höhere Aufwand für radiologische Praxen sein. Durch die aufwändige Bauweise sind die Geräte schwerer: Während ein herkömmlicher Röhren-Tomograf in etwa fünf Tonnen wiegt, bringt es ein offenes MRT auf das bis zu dreifache Gewicht. Daneben muss der Radiologie für gesetzlich versicherte Patienten oftmals einen Antrag zur Kostenerstattung bei der Krankenkasse einreichen. Zudem ist die Stärke des Magnetfelds mit maximal 1,2 Tesla etwas geringer als die Feldstärke moderner Tunnel-Systeme mit 1,5 bis 3,0 Tesla.
"Die Feldstärke ist wie die Blende beim Fotoapparat: Sie bestimmt, wie viel Licht in einer bestimmten Zeit ankommt", erklärt Cord Frieg, Vertriebsmitarbeiter vom MRT-Hersteller Hitachi Medical Systems. Entsprechend dauert bei höheren Feldstärken die Untersuchung etwas kürzer. Ob scharfe Bilder entstehen, hängt noch von weiteren Faktoren ab, sagt Frieg: "Wichtiger ist beispielsweise, ob der Patient in der Messzeit ruhig liegen bleibt." Dies gelinge in offenen MRTs eher, weil die Patienten entspannter seien.
Hitachi bleibt deshalb den offenen MRTs treu und entwickelt sie ständig weiter, zum Beispiel mit Software-Updates, die Unschärfen aufgrund von Bewegungen des Patienten während der Untersuchung verringern.
Weiterentwicklungen in verschiedene Richtungen
Einen neuen Weg geht der Hersteller Philips, der das offene System nicht mehr produziert. Philips baut stattdessen digitale Röhren-MRTs mit über 70 Zentimetern Röhrenöffnung statt bisher 60 Zentimetern. Außerdem werden die Röhren immer kürzer, so dass sich der Kopf des Patienten je nach klinischer Anwendung oft außerhalb der Röhre befindet. Weitere Hersteller fertigen ähnliche Geräte an.
Mit einer zusätzlichen Innovation lenkt Philips Patienten vom Blick in die Röhre ab: Durch eine Spiegelvorrichtung blicken sie auf eine Videowand am Ende des Tunnels. "Der Patient wird dadurch individuell durch die Untersuchung geführt", erläutert Michael Stiefvater, Manager von Philips Healthcare. "Er sieht auf dem Bildschirm, wie lange die Aufnahmen noch dauern, wann der Tisch sich bewegt und wann eine neue Sequenz startet." Außerdem zeigt die Leinwand auf Wunsch auch beruhigende Natur-Impressionen, zum Beispiel durchs Wasser schwebende Delfine und Rochen. So soll die Untersuchung fast schon Erholung, auf jeden Fall aber Schrecken verbreiten. Gleichzeitig liefert sie hochauflösende Bilder.